Texte
Das erste Jahr. Fachhochschulstudiengänge im Werden.
- Details
- Erstellt am Sonntag, 14. März 2010 07:13
Beitrag für "Sozialarbeit in Österreich" 3/2002.
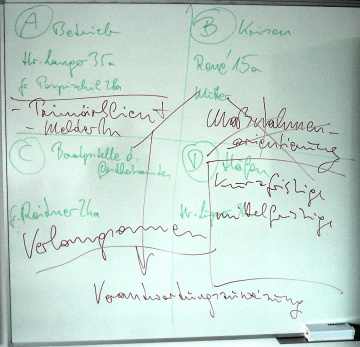
Ein Studienjahr sind sie nun alt, die ersten Fachhochschulstudiengänge Sozialarbeit in Österreich. Zeit, eine erste Zwischenbilanz zu ziehen und einen Blick zu wagen darauf, wie sich das sukzessive Ende des Sonderweges Akademien auf das Praxisfeld auswirkt.
1.
Ein Sonderweg – das sind allerdings auch die FH-Studiengänge. In einer Fachhochschullandschaft, die von technisch und/oder ökonomisch orientierten Studiengängen geprägt ist, bildet die Sozialarbeit ein Unikat, für viele auch ein ungeliebtes. Es gibt nicht nur Rückenwind für StudiengangsleiterInnen und lehrendes Personal. Auch im Praxisfeld werden die AbsolventInnen vorerst „bunte Hunde“ sein. Sie werden sowohl mit den AbsolventInnen universitärer Studien (Psychologie, Pädagogik, Soziologie, Ethnologie etc.), als auch mit den AbgängerInnen kürzerer bzw. nichtakademischer Ausbildungsgänge (Sozialpädagogik, Behindertenbetreuung, Sozial- und Lebensberatung etc.) konkurrieren. Was die fachliche Kompetenz im Sozialwesen anbelangt, hätte das schon bei den AbgängerInnen der Akademien kein Problem sein dürfen. Praktisch ist es aber immer wieder eines, und das aus mehreren Gründen:
- Das Sozialarbeitsstudium ist weiterhin ein Frauenstudium. Der Anteil der männlichen Bewerber um einen Studienplatz ist viel zu gering, dementsprechend auch die Zahl der männlichen Absolventen. Demgegenüber ist die Nachfrage nach männlichen Sozialarbeitern auf dem Arbeitsmarkt groß. Gerade in Zeiten gender-sensitiver Arbeit wird einerseits die Notwendigkeit gemischtgeschlechtlich zusammengesetzter Teams deutlich. Andererseits erfordern große Aufgabengebiete wie die Arbeit mit Tätern zwingend männliches Personal. Angesichts des Unterangebots an Sozialarbeitern werden zwangsläufig Kollegen mit anderer, oft gar nicht besonders passender, Qualifikation eingesetzt.
- Beratung, Begleitung und Reflexion sind weit über die alten Kernbereiche der Sozialarbeit hinaus zu weithin nachgefragten Dienstleistungen geworden. Die Grenzen – auch zur Therapie – verwischen sich. Im klassischen Sozialarbeitscurriculum wurde dem Training der Beratungsfertigkeiten und der Gesprächstechnik zwar immer auch, aber zuletzt deutlich zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Die Vermittlung basaler Fertigkeiten helfender Gesprächsführung wurde zugunsten abgeschlankter Varianten therapeutischer Techniken vernachlässigt. Das führte dazu, dass sich die frischgebackenen SozialarbeiterInnen in dieser – möchte man meinen – zentralen beruflichen Kompetenz nicht sicher fühlten und tatsächlich auch nicht sicher waren. Zeit- und kostenintensive therapeutische Zusatzausbildungen wurden zunehmend Anstellungsvoraussetzung dort, wo schlicht Beratung gefordert war.
- Das Image der Sozialarbeit als Disziplin ist immer noch dürftig. Das zu Recht, weil die Disziplinentwicklung (als eigene Wissenschaft, als eigener Diskussionszusammenhang auf hohem Niveau) hierzulande tatsächlich erst an einem Anfang steht. Das aber auch zu Unrecht, weil SozialarbeiterInnen mit ihrer alltagsnahen Expertise und ihrem Verständnis des Hilfsprozesses schon bisher eigenes beitragen können und für die klientInnenbezogene „Erdung“ von multiprofessionellen Teams unverzichtbar sind.
Die FH-Studiengänge übernehmen diesen Status quo der Profession als Erbe, und es ist noch keineswegs ausgemacht, dass sie daran etwas ändern können und/oder wollen. Die angepeilte Statusverbesserung durch den akademischen Abschluss hat vorerst noch nicht mehr männliche InteressentInnen angezogen. Die Curricula weisen noch keinen Schwerpunkt in Beratungstechnik und Fallinterpretation auf. Und die Disziplinentwicklung ist zwar eine hehre Aufgabe, stößt derzeit jedoch noch an die Grenzen knapper Ressourcen. Vorerst ist man voll ausgelastet damit, unter den neuen Bedingungen überhaupt das Studium zu organisieren – was nicht ohne Pannen und Unzulänglichkeiten abgeht. Die Lehrenden und die Studiengangsleitungen sind da mehr gefordert, als ihnen lieb ist.
2.
Was hat sich nun an der Studienrealität geändert im Vergleich zur Akademie? Soweit ich mich in der Folge auf Erfahrungen beziehe, tue ich dies stets aus der St.Pöltner Perspektive. Ich gehe davon aus, dass die Erfahrungen woanders zwar nicht gleich, im Kern aber ähnlich sind bzw. sein werden. Bereits im Vorfeld war die relativ starke Verschulung der FH-Studiengänge angesprochen worden. Anwesenheitspflicht (auch bei Vorlesungen) und geringe Wahlmöglichkeiten der Studierenden fördern nicht gerade selbstständiges Lernen, sind aber Teil des Fachhochschulkonzeptes, um die Drop-out-Rate niedrig zu halten. In St. Pölten wollten wir diese Vorgaben zum Anlass nehmen, insgesamt eine diszipliniertere Lern- und Arbeitskultur zu entwickeln. Dies ist zum Teil gelungen. Was für die neuen Studierenden keine Umstellung ist, ist doch eine für die Lehrenden, die aus der Akademie andere Umgangsformen gewöhnt waren. Anwesenheitspflichten schaffen nun zwar volle Hörsäle, sichern aber nicht die Aufmerksamkeit der Studierenden.
Die angestrebte Erhöhung der Qualität des Lehrangebots wird wohl nicht in einem Sprung zu verwirklichen sein, sondern erfordert eine kontinuierliche Anstrengung sowie einen intensiven Dialog mit den Studierenden. Was Hochschulniveau bei den Lehrveranstaltungen konkret bedeuten kann und soll, das ist die (noch keineswegs geklärte) Kernfrage. Klar ist jedenfalls, dass es in einem praxisorientierten Studium nicht um theoretische Abgehobenheit gehen kann, sondern um einen ständigen Diskurs zwischen Theorie und Praxis. Die Lehrenden selbst sollten diesen Diskurs repräsentieren (und führen). Wir sind darin noch ungeübt.
3.
Es ist bereits erkennbar, dass die Studiengänge die Zusammenarbeit mit dem Praxisfeld in viel größerem Ausmaß brauchen werden, als das für die Akademien gegolten hat. Insbesondere gilt das für ihren Forschungs- und Entwicklungsauftrag – aus inhaltlichen wie aus ökonomischen Gründen.
Was die Studiengänge nicht haben, sind umfangreiche Ressourcen. Dem Forschungsauftrag stehen keine Mittel gegenüber, die nur eingesetzt werden müssten. Um das zu tun, was hier möglicherweise im Feld erwartet wird, müssen sich die Studiengänge also auch um Drittmittel kümmern. Derzeit ist das noch eine Überforderung. Der Aufbau des Studiums frisst sowohl organisatorisch-administrativ als auch inhaltlich viele Energien und lässt die Zeitressourcen verknappen.
Eine Forschung, die eng an die Bedürfnisse der Praxisgemeinschaft angebunden ist, benötigt daher sowohl inhaltliche Aufträge aus dem Feld als auch die Bereitstellung von Mitteln. Die FH kann Know How und Infrastruktur zur Verfügung stellen. Was sie nicht kann und auch in Zukunft nicht können wird, ist die Organisation praxisnaher Gratisforschung.
4.
Das Praxisfeld hat seine Erstkontakte mit den neu entstandenen Fachhochschulstudiengängen schon hinter sich. Die neuen Praktikumsregelungen verlangen eine gewisse Anpassungsfähigkeit der Organisationen, und der Wegfall der Entschädigung für PraxisanleiterInnen sorgte für böses Blut. Es bleibt zu hoffen, dass die Trägerorganisationen sich der Verantwortung im System der akademischen Ausbildung ihres künftigen qualifizierten Personals bewusst werden: Die Fachhochschule sichert Ihnen, dass sie am Arbeitsmarkt bestens ausgebildete Fachkräfte vorfinden. Die Qualität und Praxisnähe des Studiums hängt aber wesentlich davon ab, dass durch Kooperationen das Studium „geerdet“ wird. Die einfachste und häufigste Form der Kooperation wird weiterhin das Praktikum sein. Der relativ geringfügige Ressourceneinsatz der Trägerorganisationen Sozialer Arbeit lohnt sich: sie finden Kontakt zum Nachwuchs der Profession (und man weiß ja, dass viele Studierende nach Praktika als Fachkräfte angeworben werden) und fördern die Praxiskompatibilität der Ausbildung. Die Praxisbetreuung vor Ort ist also eine Leistung im wohlverstandenen Eigeninteresse der Organisation. Dementsprechend ist es auch Aufgabe der Träger, die MitarbeiterInnen, die diese Leistung konkret erbringen, anderweitig zu entlasten und/oder zu belohnen.
5.
Die Installierung der FH-Studiengänge sollte die „Sackgasse“ Sozialarbeits-Ausbildung beseitigen helfen. Das ist in einem ersten Schritt für die künftigen AbsolventInnen gelungen. Als nächste Schritte stehen allerdings noch einige Aufgaben an. Zuallererst bedarf es einer Möglichkeit für die Akademie-AbsolventInnen, den Mag.(FH) zu erwerben und damit in das akademische System einzusteigen. Die letzte Novelle zum Fachhochschul-Studiengesetz eröffnete hier die prinzipielle Möglichkeit, Magisterstudiengänge anzubieten, die auf die Akademien als Quasi-Bakkalaureats-Studien aufbauen könnten. Ob diese Möglichkeit auch real wird, steht derzeit allerdings noch in den Sternen, schließlich muss das auch jemand finanzieren. Ein weiterer Schritt wäre die Sicherstellung von anschließenden Doktoratsstudien an den Universitäten. Vereinzelt bieten sich hier erste Möglichkeiten, deren Erweiterung wird in den nächsten Jahren angegangen werden müssen. Die Profession braucht dringend einen „Brain Trust“, also Personen mit hoher und höchster akademischer Qualifikation, die sich weiterhin als SozialarbeiterInnen bzw. SozialarbeitswissenschafterInnen verstehen, die Entwicklung der wissenschaftlichen Disziplin vorantreiben können und der Profession insgesamt zu höherer Wertigkeit verhelfen.
Zu dieser angesprochenen Entwicklung der wissenschaftlichen Disziplin bedarf es noch einiger anderer Initiativen:
- Etablierung eines sozialarbeitswissenschaftlichen Diskurses, z.B. müssen redigierte Publikationsmöglichkeiten geschaffen werden.
- Einmischung der Sozialarbeit in ExpertInnendiskurse auf hohem Niveau.
- die KollegInnen müssen lernen, sozialarbeiterische Expertisen sowohl fall- als auch problembezogen abzugeben.
- Heranbildung qualifizierten sozialarbeitswissenschaftlichen Lehrpersonals für die Studiengänge.
6.
Die neu angelaufenen Fachhochschulstudiengänge können zwar Keimzellen für die Weiterentwicklung der Sozialarbeit als Profession sein, aber sie sind auf die Unterstützung des Praxisfeldes angewiesen. Einerseits benötigen sie Wohlwollen und Kooperation der SozialarbeiterInnen, andererseits die Bereitschaft der Trägerorganisationen, mit den FHs zusammenzuarbeiten. Zusammenarbeiten heißt: Nicht nur Aufträge geben und Wünsche deponieren, sondern auch Mittel für Kooperationsprojekte zum beiderseitigen Nutzen flüssig zu machen. So könnte auch in Österreich die Sozialarbeit zur Leitprofession des Sozialwesens werden und diesem für den Zusammenhalt der Gesellschaft so wichtigen Sektor Impulse der Innovation und der menschengerechten Qualität geben.



