Texte
Diagnose in der Sozialarbeit. Von der Persönlichkeits- zur Situationsdiagnostik.
- Details
- Erstellt am Sonntag, 14. März 2010 07:26
Referat (und dazugehörige Folien) im Workshop der Sektion Sozialarbeit am Kongress der Österreichischen Gesellschaft für Soziologie, Wien, 26.11.2003.
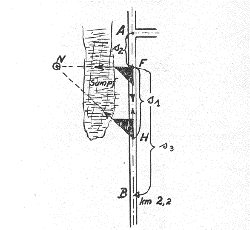
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
Am Beginn der Entwicklung der Sozialarbeit als Profession mit dem Anspruch einer wissenschaftlichen Fundierung stand die Bemühung, ihr – ganz nach dem erfolgreichen Muster der Medizin – ein diagnostisches Werkzeug in die Hand zu geben, das die Sozialarbeiterinnen als Expertinnen des Sozialen, als die Diagnostikerinnen der Hilfsbedürftigkeit für das Wohlfahrtswesen unentbehrlich machen sollten. Ich erinnere daran, dass die zentrale Leistung der Charity Organization Societies der weitgehende Verzicht auf das Verteilen von Almosen und die Konzentration auf eine individualisierte Einschätzung des Hilfebedarfs von verarmten Familien war. Mit dieser Einschätzung waren auch prognostische Leistungen verbunden.
Am Anfang stand also das Versprechen einer Erhöhung der Effizienz und Effektivität sozialer Unterstützung durch die indvidualisierte Diagnostik. Hausbesuche und das Gespräch, die Inszenierung der Beziehung, das ergab sich eher aus der Logik einer individualisierten sozialen Diagnostik der Hilfsbedürftigkeit. Um die individualisierten Daten zu bekommen, mussten Strategien der Annäherung an den lebensweltlichen Zusammenhang der KlientInnen entwickelt werden. Die sogenannte Beziehungsarbeit ermöglichte erst die Einlösung des Anspruches der Expertendiagnose.
Wir sehen also, dass die von der Sozialarbeit als Profession entwickelte Technologie der Annäherung an die KlientInnen und ihre Lebenswelten in gewissem Sinne als Abfallprodukt der Bemühungen um eine professionalisierte diagnostische Kompetenz betrachtet werden kann. Den Pionierinnen der Sozialarbeit als Profession, Mary Richmond in den USA und Alice Salomon in Deutschland, ist es noch nicht gelungen, den eigentlichen Behandlungsprozess selbst schlüssig zu beschreiben. Aber ein Nebeneffekt einer Diagnostik, die auf Gespräch, auf Lebensweltannäherung setzte, war die Kultivierung einer Annäherungstechnik, die sich bald selbst als heilend und hilfreich erwies. Die Sozialarbeit entwickelte vor allem in den Konzepten des Casework ein Verständnis der eigenen Arbeit, das zwischen dem diagnostischen Prozess und der Intervention keinen deutlichen Unterschied mehr machte. Und das war durchaus logisch, entsprach den Erfahrungen: Die Klärung der Lebenslage im notwendig kooperativen Prozess mit den KlientInnen und deren sozialem Umfeld veränderte, richtig gemacht, bereits die Lebenslage, die Beziehungen im sozialen Umfeld und die Fähigkeiten der KlientInnen zur Nutzung der Ressourcen dieses Umfelds. Man kann das klassische Konzept des Casework als ein Konzept beschreiben, das sich als Einheit von Diagnose und Intervention versteht.
Auch wenn dieses Konzept zunehmend unter Beschuss gerät, als ineffektiv, nicht zielorientiert und verwaschen etc. denunziert wird, muss man doch sehen, dass es ein Konzept der sinnvollen Reduktion von Aufwand war. Es reagierte vernünftig auf einige strukturelle Probleme, die sich bei einer wissenschaftlich und methodisch fundierten Sozialen Arbeit ergaben:
- Da ist zuerst die Komplexität des zu untersuchenden Sachverhalts zu nennen. Die Problemlagen sozialer Einbindung manifestieren sich konkret in Form von Problemen der Alltagsbewältigung, sind aber bedingt vom Zusammenspiel biologischer, psychischer und mehrerer sozialer Systeme, welch letztere wiederum gegenständliche und kommunikative Ausformungen haben. Dadurch entsteht ein komplexes Gefüge, zu dem im Vergleich die Komplexität etwa des menschlichen Körpers, der ja das bevorzugte Untersuchungsobjekt der Medizin ist, als relativ gut überschaubar gelten kann.
- Zum Zweiten ist die Grenze zwischen Funktionieren und Nicht-Funktionieren keineswegs klar bestimmt und entzieht sich über weite Strecken einer objektiven Definition.
- Zum Dritten sind die zu beschreibenden bzw. zu diagnostizierenden Systeme dynamisch – und das auf die spezielle Art, wie wir sie sowohl in der Gesellschafts-Geschichte als auch in der Individualgeschichte kennen: Perioden des relativen Stillstands werden von Zeiten rasanter Entwicklung abgelöst, wobei oft erst im Rückblick erkennbar wird, dass und welche Voraussetzungen für den Wandel bereits in den Phasen der scheinbaren Stagnation herangereift sind und schließlich den Wandel ermöglicht haben. An diesem Wandel sind dann mitunter die verschiedensten Akteure beteiligt, und der Wandel kommt nicht nur manchmal überraschend, sondern nimmt mitunter auch eine überraschende Richtung.
Im Vergleich zu Medizin und Psychotherapie agiert Sozialarbeit also in komplexeren und schlechter planbaren Environments, ist bei ihrer Diagnostik und Vorgehensplanung mit Problemen der Unübersichtlichkeit und der Unvorhersehbarkeit konfrontiert.
Dazu kommt, dass Sozialarbeit bei ihrer Informationsgewinnung über den Fall zwar nicht ausschließlich, aber doch weitgehend auf Gespräche angewiesen ist, und die Qualität der Informationen vom Gelingen der Gesprächsführung abhängt.
Natürlich stimmt das nicht ausschließlich. Eine Reihe von Daten über den Fall extrahiert die Sozialarbeit aus Akten, Schriftstücken, Befundungen etc., also aus bereits vorliegenden oder beschaffbaren Beschreibungen von Aspekten der Lebenssituation der KlientInnen. Weitere Daten werden durch Beobachtung gewonnen. Aber das Herzstück war bisher doch das Gespräch, und ich nehme an, dass das noch längere Zeit so bleiben wird.
Gespräche sind langsam, vor allem wenn man durch sie einen komplexen Sachverhalt erschließen will. Und das Gelingen der Informationsbeschaffung durch das Gespräch hängt von der Beziehungsgestaltung ab: Die KlientInnen müssen auf irgendeine Art davon überzeugt werden, dass es für sie sinnvoll ist, die Informationen preiszugeben.
Eine alte Technologie, die das bewerkstelligen kann, ist die Folter. Wie wir wissen, ist selbst die langsam und aufwändig, und die Qualität der durch sie gewonnenen Informationen ist auch nicht immer hoch. Auch unter der Folter sagen die so behandelten Personen oft das, was sie glauben, dass der Interviewer hören will, und nicht die sogenannte Wahrheit.
Also bietet sich eher die Strategie des „good guy“ an: die Zurschaustellung von Verständnis und Vertrauenswürdigkeit. Die Informationsgewinnung wird dadurch zwar nicht wesentlich beschleunigt, dafür kann eine soziale Beziehung aufgebaut werden, die die weitere Kooperation der KlientInnen wahrscheinlicher macht und die Ausgangslage nicht von vornherein verschlechtert.
Das Problem der Komplexität wird dadurch allerdings noch nicht wirklich gelöst. Wir erhalten ein subjektives Bild der Lebenssituation, und eines, das auch bei einem längeren Gesprächsprozess noch zahlreiche blinde Stellen aufweisen wird. Gleichzeitig aber können bereits nach kurzer Zeit durch den schon für die Informationsbeschaffung nötigen Beziehungsaufbau Voraussetzungen für die kooperative Bearbeitung von Alltagsproblemen der KlientInnen geschaffen werden. Was also liegt auch aus Gründen der Arbeitsökonomie näher, als ein ohnehin nicht absehbares Ende des Verfahrens der Informationsbeschaffung gar nicht erst abzuwarten, sondern gleichzeitig zum Prozess der Diagnose mit der aktiven Arbeit zur Problemlösung zu beginnen. Man gewinnt dadurch ein zusätzliches und durchaus mächtiges Instrument der Diagnose in die Hand gespielt, nämlich das Experiment. Beim Versuch der Änderung einer Situation, einer Bedingung, erwachsen aus der Beobachtung, wie was oder wer dabei kooperiert oder Widerstand leistet, wertvolle neue Informationen. Wir erkennen wesentliche Aspekte der Situation an der Widerständigkeit, die Veränderungsversuchen entgegengesetzt wird – oder auch nicht.
Ein so verstandener Prozess der Sozialarbeit ist eben nicht durch den aus der Medizin bekannten Dreischritt Anamnese – Diagnose – Intervention gekennzeichnet, sondern die Anamnese ist schon Beratung, diagnostische Schritte sind bereits Interventionen, und Interventionen treiben die Diagnose voran. Wir beobachten einen anspruchsvollen Prozess des Dialogs der PraktikerInnen mit den KlientInnen und deren Umfeld, der gesprächsförmig und eingreifend-organisierend ist. Interventionen werden dort angesetzt, wo sie jetzt möglich sind, mitunter auch mit nur vager Kenntnis des Gesamtzusammenhangs.
Um noch einmal auf den Beginn meines Referats Bezug zu nehmen: Diese Strategie ergibt sich durchaus logisch aus der berufsgeschichtlich ursprünglichen Konzentration der Sozialarbeit auf die Diagnose. Und es ist eine arbeitsökonomisch sinnvolle Strategie. Das muss vor allem deswegen betont werden, weil die WortführerInnen der Verbetriebswirtschaftlichung der Sozialarbeit diese klassische Casework-Strategie als überholt und ineffizient brandmarken.
Psychotherapeutisierung als Komplexitätsflucht
Ich habe diese Grundsituation jetzt ausführlich dargestellt, um zu zeigen, wie sich in der Sozialarbeit der Fokus von der Diagnose zum Prozess verschoben hat. Das ging so weit, dass der Begriff der Diagnose selbst aus dem sozialarbeiterischen Sprachgebrauch nahezu vollständig verschwunden ist. Das änderte aber nichts an den oben genannten Ausgangsbedingungen. Weder daran, dass sich die PraktikerInnen in ihren Interventionen an einer wie auch immer gearteten Lageeinschätzung orientieren mussten und müssen, nichts an den Problemen der Komplexität, der Dynamik und der Unbestimmbarkeit der Grenze zwischen Funktionieren und Nicht-Funktionieren. Diese Probleme mussten und müssen trotzdem bearbeitet, irgendwie gelöst werden. Nicht zu vergessen arbeiten SozialarbeiterInnen auch in Feldern, in denen auf Basis ihrer Situationseinschätzung mitunter weitreichende Entscheidungen getroffen werden, die in die Biografien von KlientInnen eingreifen und Chancen zuteilen oder verweigern. Als Beispiel mag dafür das Jugendamt gelten, aber eben nur als Beispiel, denn auch in anderen Arbeitsfeldern fungieren SozialarbeiterInnen als Gatekeeper für die Zuteilung von sozialen Chancen und Möglichkeiten. Ein vor allem am Prozess orientiertes berufliches Selbstverständnis konnte den PraktikerInnen keine ausreichende Hilfestellung geben, weder für die Gestaltung eines umweltbezogenen Interventionsprozesses, noch für die fachliche Begründung klientenbezogener Entscheidungen. Dies begünstigte und begünstigt den Rückgriff auf diagnostische Modelle (und auf „diagnostische“ Verfahren unter Anführungszeichen), die dem Fach und dem Gegenstand wenig angemessen waren und sind.
In erster Linie sind hier psychologische und psychotherapeutische Angebote zu nennen, die doppelt nahe liegen:
1. sind psychologisierende Deutungsmuster im letzten Jahrhundert in hohem Maße in das Alltagsbewusstsein diffundiert. Sie liegen damit sozusagen auf der Straße, müssen nur aufgegriffen werden, und werden auch aufgegriffen. Diese Erklärungsmuster sind als Bestandteil alltäglicher Deutungsmuster natürlich trivialisiert. Sie sind anschlussfähig, weil sie auch bei den KommunikationspartnerInnen, mit denen SozialarbeiterInnen zu tun haben, bereits als Deutungsmuster vorliegen. Die Legitimation ihrer Situationsdeutungen beziehen die SozialarbeiterInnen als Fachkräfte dann nicht aus ihrer Fachlichkeit (was hieße: zumindest partiell auch aus der Unzugänglichkeit ihrer Erhebungsverfahren und Entscheidungsfindung für andere), sondern aus der bloßen Tatsache ihres intensiveren Kontaktes zum Klientel.
2. Psychologische und psychotherapeutische Verfahren und Deutungen lagen auch deshalb nahe, weil sie eine ähnliche Orientierung am Prozess haben, und doch auch ein diagnostisches Instrumentarium zur Verfügung stellen. Sie ermöglichen die Flucht aus der Komplexität des Gegenstands der Sozialarbeit, ohne das Gelände völlig verlassen zu müssen. Die Konzentration auf das Psychische sichert den ExpertInnenstatus, und rettet doch vor der Zumutung des Umgangs mit zu hoher Komplexität.
Verlust der diagnostischen Kompetenz
Für die Profession war diese Entwicklung existenzgefährdend. Wie schon Strotzka die Sozialarbeit als Psychotherapie für die Armen verstand, verstanden viele SozialarbeiterInnen ihren Beruf nun als verarmte Psychotherapie. Das Fehlen einer genuin sozialarbeiterischen Diagnostik, also von standardisierten Verfahren zur Generierung von Entscheidungsgrundlagen und Einschätzungen, engte auch das Verständnis des Begriffes in der Berufsgruppe ein und brachte ihn in Misskredit. Diagnostik wurde mit Persönlichkeitsdiagnostik identifiziert. Folgerichtig entwickelte sich eine Kritik an einer defizitgeilen Störungsdiagnostik mit stigmatisierenden Folgen, denn das kannte man ja. Die prinzipielle Offenheit der Sozialarbeit gegenüber den Weltsichten und Alltagsarrangements der KlientInnen schien eine notwendigerweise normenorientierte Diagnose auszuschließen.
Tatsächlich zeichnete und zeichnet sich eine klientenorientierte Sozialarbeit dadurch aus, dass sie den schwierigen Prozess des Verstehens nicht durch frühe persönlichkeits- oder störungsdiagnostische Festlegungen frühzeitig abkürzt und beendet. Wie ich in meiner Arbeit über das Krisenzentrum FIDUZ gezeigt habe, war der konsequente und aktive Verzicht der Fachkräfte auf eine prinzipiell bereitliegende, ja sich geradezu aufdrängende Störungsdiagnostik Voraussetzung für deren erfolgreiche Fallbearbeitung. Erst dadurch, dass sie Kinder nicht als „hyperaktiv“, „verhaltensgestört“ usw. verstanden, sondern versuchten, den Sinn ihres Verhaltens aus dem situativen Kontext zu erschließen, eröffneten sich die entscheidenden Interventionsmöglichkeiten.
Oder anders gesagt: Erst dann, wenn die Probleme nicht primär in den Personen verortet werden, eröffnet sich das reiche Handlungsfeld der Sozialarbeit. Befunde über den körperlichen und psychischen Zustand der KlientInnen, die Medizin und Psychologie liefern, bezeichnen Rahmenbedingungen der Arbeit am Fall, so wie das juristische Expertisen über die rechtlichen Rahmenbedingungen tun.
Wenn ich nun den Verlust der diagnostischen Kompetenz der Sozialarbeit beklage, beklage ich nicht diese Verweigerung von Persönlichkeits- und Störungsdiagnostik. Im Gegenteil: In dem Maße, in dem Sozialarbeit sich ausschließlich auf den Prozess orientierte und eigene diagnostische Fähigkeiten nicht mehr als zentralen Teil beruflicher Kompetenz begriff, öffnete sie der medizinischen, psychiatrischen und psychologischen Diagnostik Tür und Tor, konnte diese nicht mehr durch eigene Leistungen ergänzen, relativieren, konterkarieren. In einem Gespräch mit den Ärzten eines multiprofessionellen Teams haben jene das so formuliert: SozialarbeiterInnen scheinen immer nur die Position der KlientInnen zu verdoppeln. Sie werben um Verständnis für die KlientInnen und scheinen keine eigene Position zu haben. Oder sie können nicht nachvollziehbar begründen, wie sie zu ihren Einschätzungen, Empfehlungen und Entscheidungen kommen. Ihre Gutachten scheinen bestenfalls auf einem unkontrollierten Common Sense zu beruhen.
Keine Frage, dass in einer Praxislandschaft, die zunehmend von mehrprofessioneller Kooperation geprägt ist, eine solche Profession schlechte Karten hat – und zwar sowohl berufspolitisch als auch in fallbezogenen Entscheidungsprozessen.
Dieser traurige Zustand fachlicher Sprachlosigkeit wird nun von zumindest 2 Seiten wirkungsvoll kritisiert.
1. Die Träger der Sozialen Arbeit, vor allem die Managementebenen, drängen auf eine bessere Beschreibbarkeit und Steuerbarkeit der Sozialarbeit. Sie müssen zunehmend Leistungsbeschreibungen erstellen, um ihre Finanzierung zu sichern. Dabei ist ihnen eine Orientierung an von der Legislative und dem ministeriellen Beamtenapparat formulierten Zielen und Kennzahlen vorgegeben. Während die Medizin die Definitionsmacht darüber hat, was eine Krankheit ist und was nicht (wobei es in ihrem Interesse liegt, möglichst jede Normabweichung als Krankheit zu definieren), hat die Sozialarbeit nicht die Definitionsmacht darüber, was ein soziales Problem ist. Die Definition eines sozialen Problems ist ein öffentlicher diskursiver Prozess, ein seinem Wesen und letztlich auch seiner Form nach politischer Prozess. Die Träger, denen eine stärkere Flexibilität bei der Erbringung von Dienstleistungen an die Politik abverlangt wird, verlangen diese Flexibilität und bessere Steuerbarkeit zunehmend auch von ihrem Personal. Über Produktbeschreibungen, ausgefeiltere Dokumentationssysteme und die genauere Definition von Abläufen soll die relative Offenheit der sozialarbeiterischen Beratungs- und Betreuungsprozesse besser einer „verkaufbaren“ Darstellung, aber auch einer Steuerung durch Entscheidungen des Managements zugänglich gemacht werden. Definierte und überprüfbare Betreuungsziele, frühzeitige begründete Festlegungen auf einen gewünschten Verlauf des Prozesses und damit auch auf den zu erwartenden Mitteleinsatz sollen die überprüfbare Effizienz des Prozesses erhöhen. Damit wird der einseitigen Orientierung der Methodik auf ergebnisoffene und wenig vorhersagbare Prozesse der Kampf angesagt.
2. Ergänzend und alternativ dazu ist es ein aus nicht-professionellen Zusammenhängen importiertes Qualitätsverständnis, das ebenfalls auf beschreibbare immergleiche Prozesse und vorweg definierte überprüfbare Zielsetzungen abhebt, das Sozialarbeit nicht mehr so weitermachen lässt, wie bisher.
Fatal ist diese Situation insofern, als der Sozialarbeit als Profession das Instrumentarium fehlt, um sich diesen Zumutungen auf der Basis eines eigenen, innerhalb der Profession als Standard erprobten und anerkannten Katalogs von Verfahren der Diagnose, der Prozessgestaltung, der Dokumentation und der Begutachtung zu stellen. Die Administrationen und die Qualitätsmanager haben so die Möglichkeit, sich als jene darzustellen, die der Profession erst fachliche Standards beibringen. Und das ist nicht nur beschämend, sondern auch kontraproduktiv. Denn naturgemäß stehen bei deren strukturierenden Innovationen die Bedürfnisse der Administration im Vordergrund.
Ich widmete mich in den letzten Monaten vor allem dem Problem der Sozialen Diagnose, also den diagnostischen Verfahren, die in sozialarbeiterischen Unterstützungsprozessen sinnvoll eingesetzt werden können, die den Prozess befördern, möglichst nicht-stigmatisierend sind und die für den sozialarbeiterischen Handlungsraum relevante Sachverhalte erfassen. Welche das sein können, dazu werde ich dann gleich etwas sagen. Vorerst aber möchte ich beispielhaft auf einen Mangel hinweisen, der zeigt, wie hilflos die Sozialarbeit als Profession den administrativen Strukturierungen ausgesetzt ist:
Um präziser beschreiben zu können, welche diagnostischen Verfahren in welchem Kontext sinnvoll angewendet werden können, hätte ich eine Terminologie gebraucht, die die verschiedenen Arbeitsformen der Einzelfallhilfe voneinander abgrenzt. Eine solche Terminologie gibt es nicht, ja es gibt nicht einmal einen Begriff, der jene ganz charakteristische Arbeitsform der Profession bezeichnet, die aus der Kombination von Beratung mit netzwerkorientierten Interventionen in relevanten sozialen Umwelten besteht. Durch den Allerweltsbegriff der Betreuung ist diese Arbeitsform nur unzureichend charakterisiert, und Beratung ist offensichtlich nur ein Teil der Methode. In einer früheren Publikation habe ich hilflos und wahrscheinlich nicht ganz glücklich in diesem Zusammenhang den Begriff Alltagsrekonstruktion geprägt und ihn von bloßer Beratung einerseits und Alltagsbegleitung andererseits abgegrenzt. Natürlich wurde das von niemandem aufgegriffen. Das wäre zu verschmerzen, wenn sich eine andere Terminologie, die zumindest diese Unterscheidung erlaubt, durchgesetzt hätte. Davon kann aber keine Rede sein.
Für meine genannten Zwecke musste ich nun eine eigene Klassifizierung der verschiedenen Interventionsformen der Einzelfallarbeit entwickeln, die wahrscheinlich eine ebenso unbeachtete insuläre Existenz fristen wird. (sh. Folien)
Ich verzichte darauf, sie hier genauer zu erläutern. Fakt ist, dass die Profession als Profession sichtbar nicht funktioniert, weil es ihr nicht einmal gelingt, ihre eigenen grundlegenden Arbeitsformen differenziert mit Namen zu versehen – weshalb auch der methodische Diskurs sich eher an Modethemen abarbeitet und immer wieder seltsam zusammenhanglos erscheint.
Die Mittel, die den SozialarbeiterInnen zur fallbezogenen Entscheidungsfindung zur Verfügung stehen, sind ebenso wenig bezeichnet und beschrieben, damit sind sie auch nicht diskutierbar. Bei aller Betonung der Notwendigkeit des offenen Dialogs mit den KlientInnen muss doch auch bedacht werden, dass ein Dialog ohne eigene Lageeinschätzung nicht geführt werden kann – und der Weg zur Entscheidungsfindung Nachvollziehbarkeit und eine gewisse Transparenz benötigt. Nur dann kann ein fachlicher Diskurs über gute und schlechte Entscheidungen geführt werden, nur dann besteht eine Chance, dass sozialarbeiterische Falleinschätzungen im interprofessionellen fallbezogenen Dialog bestehen können.
Anforderungen an eine Soziale Diagnose
Ich bezeichne diese Verfahren, deren sich die Sozialarbeit bedienen kann, in bewusster Anlehnung an die Pionierinnen der Sozialarbeitwissenschaft als Soziale Diagnose, weil m.E. damit jener Fokus bezeichnet wird, der sozialarbeiterische Diagnostik von medizinischer und psychologischer Diagnostik unterscheidet.
Angesichts der eingangs geschilderten Komplexität des Gegenstands ist es eine Illusion anzunehmen, dass es ein Verfahren geben könnte, das zu „dem“ klassischen oder zentralen Verfahren der Sozialen Diagnose werden könnte. Alle Raster, alle Visualisierungen und Verfahren zur Ordnung von Daten können jeweils nur einen oder einige wenige Aspekte beleuchten. Die Entscheidung, wann welche Verfahren eingesetzt werden können und sollen, ist also wieder eine, die aus dem Prozess heraus zu treffen ist. Desgleichen werden Soziale Diagnosen den Prozess bzw. die daraufhin zu treffenden Interventionsentscheidungen nicht vollständig determinieren können.
Welche Anforderungen sind nun an eine neue Soziale Diagnose zu stellen? Ich nenne hier nur die zwei wichtigsten:
1. Ein Verfahren der Sozialen Diagnose muss einen Ausschnitt des Verhältnisses Mensch – soziales Umfeld erfassen und abbilden.
2. Es darf den Unterstützungsprozess selbst nicht behindern, sondern soll ihn möglichst vorantreiben.
Diese beiden Voraussetzungen zu beachten heißt, Verfahren nicht nur nach dem Erkenntnisgewinn für die ExpertInnen einzuschätzen, sondern auch danach, welche Wirkungen ihre Anwendung bei den KlientInnen entfaltet und wie sie die Kommunikation zwischen KlientIn und SozialarbeiterIn beeinflusst. Ich werde das bei den Beispielen andeutungsweise darstellen.
Gesamtsicht oder problembezogene Bescheidenheit?
In der Sozialarbeit wurden in den letzten ca. 15 Jahren zunehmend Modelle systematischer Erhebung und Bedürfniseinschätzung unter dem Titel „Assessment“ verwendet. Sie erheben den Anspruch, die Lebenslage der KlientInnen einigermaßen umfassend zu erfassen und auf Basis der Erhebung der Bedürfnisse eine Hilfeplanung zu ermöglichen. Das Assessment ist als erste Phase eines Case Management Prozesses fixer Bestandteil dieses Arbeitskonzepts. Es kommt, wie Case Management generell, bei KlientInnen mit multiplen Problemlagen zum Einsatz.
Dieses Instrument ist sinnvoll, um eine bedürfnis- und lebenslagenangemessene Konzertierung von Hilfen vornehmen zu können. Allerdings ist davor zu warnen, dass die Ansprüche an ein Assessment auch völlig überzogen werden können. In der i.d.R. nur relativ kurzen zur Verfügung stehenden Zeit am Beginn eines Unterstützungsprozesses ist es illusorisch, eine tatsächliche Gesamtbestandsaufnahme der Situation leisten zu können. Jedes Assessment ist notwendigerweise trotz seines und wegen seinem umfassenden Anspruch nur eine holzschnittartige Darstellung eines Geländes, das man nur vom Hörensagen kennt.
Diagnostische Verfahren haben m.E. zwei Funktionen zu erfüllen: In einem ersten Schritt müssen sie durch ihre Konstruktion, durch die Logik und die Anforderungen des Verfahrens, zur Komplexitätsgewinnung beitragen, d.h. sie müssen der Erschließung nicht-naheliegender Informationen dienen. Sie leisten das i.d.R. dadurch, dass sie eine gewisse Systematik beinhalten, die quer zur Ablauflogik eines normalen Gesprächs oder der pragmatischen Alltagslogik liegt. In einem zweiten Schritt können dann aufgrund der so gewonnen strukturierten Datenlandschaft Entscheidungen getroffen werden – i.d.R. Entscheidungen über eine Interventionsstrategie.
Manchmal werden diese Entscheidungen Thematisierungsentscheidungen sein – d.h. dass auf Basis der Diagnose entschieden wird, welche Themen die SozialarbeiterInnen von sich aus in der Beratung fokussieren. Eine Funktion von Diagnosen kann man also als eine heuristische Funktion beschreiben: die Diagnostik stellt eine Suchstrategie dar, die jenseits des Banalen und Offensichtlichen thematische Ansatzpunkte zu finden hilft. Oder andersrum: Die aufgrund der neutralen Struktur ihres Erhebungsduktus Banales erst wieder offensichtlich macht (so wie z.B. das in der Folge vorzustellende Inklusion-Chart in hoher Verdichtung einige wesentliche Elemente der Einbindung der KlientInnen in gesellschaftliche Funktionssysteme unabhängig vom präsentierten Problem erfasst).
Ich stelle nun einige Instrumente vor, die m.E. die vorhin genannten Bedingungen für Soziale Diagnoseverfahren auf sehr unterschiedliche Art, aber doch erfüllen.
Beispiel 1: Die Netzwerkkarte
(sh. Folien)
Die Netzwerkkarte ist ein Instrument der kooperativen Diagnostik. Sie hat als theoretischen Hintergrund die Netzwerktheorie. Unter den verschiedenen Verfahren der Netzwerkdiagnostik, unter denen prominent auch das P3S, der Personal Social Support Survey nach Pearson, zu nennen ist, wähle ich die Netzwerkkarte als Instrument aus, weil sie relativ genau ist und gut in einen Beratungsprozess eingebaut werden kann. Außerdem ermöglicht sie durch die Konstruktion von Daten in einem Bild das Erkennen von Zusammenhängen und Änderungsmöglichkeiten, die anders nicht so leicht zugänglich wären. Nach meinen Erfahrungen gelingt nach kurzer Einübungszeit SozialarbeiterInnen auch bald die Anwendung in der Praxis und die Ergebnisse sind bei einem relativ hohen Anteil von Fällen relevant, d.h. sie eröffnen neue Perspektiven für die Fallbearbeitung.
Wie auch bei anderen diagnostischen Verfahren handelt es sich hier nicht nur um ein Notationssystem, also das Festhalten von Informationen, sondern der diagnostische Prozess ist zweistufig: Zuerst wird die Netzwerkkarte erstellt, in sie fließen Informationen ein, die z.T. bereits vorliegen, z.T. im Gespräch erhoben wurden. Genaugenommen erfordert natürlich bereits die Umsetzung in die Grafik Interpretationsarbeit. Mit der Erstellung der Grafik kann der Prozess in die zweite Phase treten. Das Bild selbst wird Gegenstand der Interpretation, wobei man sich bei dieser Interpretation im Arsenal der Netzwerkwissenschaft bedienen kann.
Um diesen zweiten Schritt bewältigen zu können, ist aber eine Einschulung in die Technik der Netzwerkdiagnostik erforderlich. Werden Netzwerkkarten (oder andere Instrumentarien, wie das anschließend vorgestellte Inklusions-Chart) für die Begutachtung verwendet, ist eine schriftliche Zusammenfassung und Interpretation erforderlich.
Beispiel 2: Inklusionschart
(sh. Folien)
Entgegen der schon einigermaßen erprobten Netzwerkkarte ist das Inklusionschart ein Instrument, das ich im Anschluss an die z.B. von Heiko Kleve vertretene Sichtweise von Sozialarbeit als Profession des Inklusions-Managements entwickelt habe bzw. dzt. noch entwickle. Es werden Niveau und Tendenzen der Inklusion der KlientInnen in relevante gesellschaftliche Funktionssysteme auf einer einfachen 5-stufigen Skala erfasst, daneben wird die derzeitige Tendenz festgehalten und schließlich in einer Textspalte der Stand kurz erläutert.
Das Instrument ist noch kaum getestet, außer für Fälle einer niederschwelligen Einrichtung für Drogenabhängige. Dort fällt sehr rasch auf, dass die Mehrzahl der KlientInnen von vielfachen Exklusionen betroffen sind. Durch das Instrument nicht darstellbar sind jene Elemente unmittelbarer Bedürfnisbefriedigung, die von den Sozialeinrichtungen subsidiär übernommen werden, zum Beispiel das zur Verfügung Stellen eines Wohnplatzes.
Die Stärke des Instruments liegt sicher darin, dass es einen raschen Überblick über die Inklusion der KlientInnen liefert und Gefahrenmomente sichtbar macht. Es ist nach kurzer Einarbeitung leicht handhabbar. Im Gegensatz zur Netzwerkkarte ist die Inklusions-Chart weniger für kooperative Diagnostik geeignet und erleichtert eher den SozialarbeiterInnen die Findung und Begründung einer Betreuungsstrategie.
Beispiel 3: Skalierungen und Black Box Diagnostik
Als Black Box Diagnostik bezeichne ich jene Formen der Diagnostik, die nicht einer Erweiterung des Wissens der ExpertInnen dienen, sondern die Eigendiagnose der KlientInnen strukturieren. Das kann so weit gehen, dass die SozialarbeiterInnen keine Kenntnis vom Ergebnis erlangen. Ich stelle hier nur ein kleines Beispiel vor, das leicht überall angewandt werden kann.
Das kleine Verfahren besteht in der Aufforderung an den Klienten, bis zur nächsten Sitzung eine Rangliste der Probleme zu erstellen, die er bearbeitet haben will. Die Anweisung kann auch noch dadurch ergänzt werden, dass er das auch mit seiner Partnerin oder mit anderen wichtigen Personen aus seinem sozialen Umfeld besprechen soll. Diese Rangliste wird dann zur Grundlage der kooperativen Beratungs- und Hilfeplanung genommen. Die entscheidenden Prozesse finden da unter Ausschluss der SozialarbeiterInnen statt. Zentrale Leistung des Verfahrens ist, dass die Eigendiagnose der KlientInnen zu einer Entscheidung weiterentwickelt wird, die eine sehr gute Grundlage für die weitere Fallbearbeitung liefert.
Wesentlich aufwändigere Verfahren der Black Box Diagnostik sind die Family Group Decision Making Programmes, in denen bei drohender Fremdunterbringung von Kindern nach einer Konfrontation durch die Behörde die erweiterte Familie in einer Konferenz die Lage bespricht und dann dem Jugendamt und/oder dem Gericht Alternativvorschläge unterbreiten kann.
Beispiel 4: Das Klassifikationssystem PIE
(sh. Folien)
Schließlich will ich noch das Person In Environment Classification System erwähnen, das in den USA von Karls und Wandrei entwickelt wurde und für den Arbeitsbereich der Sozialarbeit von der Intention her eine ähnliche Rolle wie das ICD10 in der Medizin spielen soll.
Auch wenn es fraglich ist, ob das jemals gelingen kann, ist der Versuch trotzdem interessant. Das PIE verwendet „Problem“ als zentralen Begriff und umfasst 4 Achsen, von denen 2 im engeren Sinne sozialarbeiterische Achsen sind.
Die Achse 1 umfasst „Probleme in Rollen“. Hier ist die Terminologie interessant.
Mit der Entscheidung für „Problem“ als zentralen Terminus wird der thematischen Offenheit der Sozialarbeit Rechnung getragen. Was als Problem bezeichnet werden kann, ist von den Sichtweisen und Definitionen der Beteiligten abhängig und bezieht sich nicht notwendigerweise auf eine als allgemeingültig vorausgesetzte Norm. Insofern ermöglicht das PIE eine nicht-stigmatisierende Klassifikation. Es wird das Problem verortet und mit einigen Indizes versehen: Problemtyp, Intensität, Dauer und Copingfähigkeiten. Die Kombination dieser Indizes erleichtert eine Problemreihung, die letztlich im Ergebnisblatt erfolgt und eine Beschränkung auf maximal 3 zu bearbeitende Probleme je Achse verlangt.
Die Achse 2 vermisst die Probleme in der Umwelt der KlientInnen, soweit sie für sie relevant sind. Achse 3 fokussiert das psychische, Achse 4 das physische Funktionieren.
Aufgaben zur Entwicklung Sozialer Diagnose
Angesichts der geringen Bereitschaft zur Entwicklung von Standards innerhalb der Profession kann dem PIE allerdings keine große Zukunft vorausgesagt werden. Dokumentationssysteme in der Sozialarbeit werden, wie ich bereits beklagt habe, vorwiegend durch die Bedürfnisse der Organisationen bzw. der Administration determiniert. Eine selbstständige sozialarbeitswissenschaftliche Beschäftigung mit der Entwicklung von diagnostischen und Klassifikationsverfahren könnte auf Perspektive die Situation verbessern.
Dafür wären allerdings einige Anstrengungen erforderlich. Ich habe in meiner Beschäftigung mit dem Thema ca. 15 weitere Verfahren untersucht und/oder zu beschreiben versucht. Für fast alle wären Probeläufe unter kontrollierten Bedingungen und mit einer Auswertung der Erfahrungen erforderlich, um sie guten Gewissens für einen breiteren Gebrauch empfehlen zu können. Für einige Verfahren, etwa die Netzwerkkarte und die Inklusions-Chart wären kleine Manuale zu entwickeln, die eine kompetente Handhabung erleichtern und die Interpretation anleiten.
Idealer Standort für eine solche Entwicklungsarbeit wären die Fachhochschulen, die dafür allerdings kooperierende Organisationen und finanzielle Mittel benötigten. Vorerst ist beides zwar noch nicht in Sicht, allerdings gibt es Anzeichen für ein Interesse mancher Träger der Sozialarbeit an einer fundierten und der Spezifik der Sozialarbeit angemessenen Diagnostik. Ob dieses Interesse so weit geht, dass sie auch in die Entwicklung zu investieren bereit sind, bleibt vorerst einmal dahingestellt.
In meiner Beschäftigung mit der Thematik überraschte mich jedenfalls das Potenzial, das in einer neuen Sozialen Diagnostik steckt. Es lohnt sich, nach fast hundert Jahren professioneller Entwicklung die Ansprüche der Gründermütter wieder aufzugreifen – nun in Kenntnis der bisherigen Entwicklung und Erfahrung.
Literatur
Adler, Helmut (1998): Eine gemeinsame Sprache finden. Klassifikation in der Sozialen Arbeit - Ein Versuch: das Person-In-Environment System (PIE). In: Blätter der Wohlfahrtspflege 7+8. S. 161-164.
Bassarak, Herbert / Genosko, Joachim (2001): Die Stärke stillen Wissens und schwacher Beziehungen. Zur Funktion und Bedeutung von Netzwerken und Netzwerkarbeit. In: Mitteilungen des LJA Westfalen/Lippe 149. S. 5-12.
Bullinger, Hermann / Nowak, Jürgen (1998): Soziale Netzwerkarbeit. Eine Einführung für soziale Berufe. Freiburg im Breisgau.
Gerhardter, Gabriele (1998): Netzwerkorientierung in der Sozialarbeit. In: Pantucek, Peter/Vyslouzil, Monika: Theorie und Praxis lebensweltorientierter Sozialarbeit. St.Pölten. S. 49-72.
Karls, J.M. / Wandrei, K.E. (1992): PIE – A New Language for Social Work. In: Social Work Nr. 37. Washington DC. S. 80-86.
Karls, J.M. / Wandrei, K.E. (Eds.) (1994): PIE-Manual. Person-In-Environment System. Washington.
Merchel, Joachim (1994): Von der psychosozialen Diagnose zur Hilfeplanung – Aspekte eines Perspektivenwechsels in der Erziehungshilfe. In: Institut für Soziale Arbeit e.V. (Hg.): Abschlussbericht zum Projekt „Fachliche und organisatorische Gestaltung der Hilfeplanung nach §36 KJHG“ im Jugendamt Herne. Münster. S. 44-63.
Pantucek, Peter (2001): Intervention im Familienkonflikt. Diplomarbeit am Institut für Soziologie der Universität Wien. Wien.
Pearson, Richard E. (1997): Beratung und soziale Netzwerke. Eine Lern- und Praxisanleitung zur Förderung sozialer Unterstützung. Weinheim und Basel.
Peters, Friedhelm (Hg.) (1999): Diagnosen – Gutachten – Hermeneutisches Fallverstehen. Frankfurt am Main.
Richmond, Mary (1917): Social Diagnosis. New York.
Salomon, Alice (1926): Soziale Diagnose. Berlin.
Turner, Francis J. (2002): Diagnosis in Social Work. New Imperatives. New York.
- Zurück
- Weiter >>



